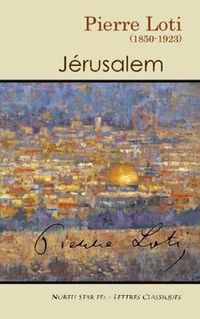Der französische Dichter Pierre Loti besuchte im Jahre 1895 Jerusalem und schrieb über diese Reise ein Tagebuch. Es ist für den heutigen Leser, vor allem wenn er Jerusalem kennt, ein höchst interessantes Stimmungsbild der heutigen israelischen Hauptstadt im ausgehenden 19. Jahrhundert.
Leider enthält das Buch mehrere Passagen, die nach heutigem aber auch damaligem Verständnis als eindeutig antisemitisch eingestuft werden müssen. Die neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts waren in Frankreich geprägt durch die Dreyfusaffäre; die Haltung, die Pierre Loti in dieser Auseinandersetzung um einen aus judenfeindlichen Gründen entlassenen General eingenommen hat, ist bis heute umstritten und Gegenstand der Forschung. Durchgehend antisemitisch war er wohl nicht, denn an anderen Stellen äußert er sich durchaus respektvoll über das Judentum.
Nichtsdestoweniger sollten die gelungenen Teile seiner Beschreibung Jerusalems nicht verloren gehen. Ich habe deshalb wesentliche Teile des Buches übersetzt und dabei die antisemitischen Passagen weggelassen; bei zweifelhafter Ausdrucksweise habe ich mir auch die Freiheit genommen, im Deutschen eine Wortwahl zu treffen, die Beleidigungen ausschließt. Um den Lesegenuss nicht zu beeinträchtigen, habe ich die Auslassungen nicht gekennzeichnet.
Die Bilder sind größtenteils Screenshots von Youtube-Videos über Jerusalem vor der Staatsgründung Insraels. Die Quellen sind unter dem Text angegeben. | | Ich wünsche trotz dieser Einschränkungen viel Freude beim Lesen. |
Der Regen, der strömende Regen, der unaufhörliche Regen hatte uns gestern den ganzen Tag, seit unserer Ankunft bis zum Abend, gefangen gehalten.
Auch heute fällt wieder der gleiche Regen unter einem nördlichen wirkenden Himmel. Das Gefühl, in Jerusalem zu sein, geht in der Ödnis eines Touristenhotels verloren, wo wir nah beim Feuers eingesperrt sind, nachdem wir zu unseren westlichen Kleidern und Umgangsformen zurückgefunden haben.
Gegen Abend jedoch verlassen wir das Hotel zum ersten Mal: der französische Generalkonsul war gekommen und hatte mit charmanter Liebenswürdigkeit angeboten, uns zwischen zwei Regenschauern zu den Dominikanervätern zu bringen, die außerhalb der Mauern ganz in der Nähe wohnen und die, so meint er, auf seine Bitte hin zweifellos bereit sein würden, uns in der heiligen Stadt als kundige Führer zu dienen.
Als es kurz heller wird, erblicken wir im Vorbeigehen das wunder-bare Damaskustor. Es ist das mächtigste und erlesenste der sarazenischen Tore. Sein Bogen durchschneidet die düstere Mauer; es wird von zwei düsteren Türmen flankiert; Steinspitzen überkrönen es, scharf wie das Eisen eines Speers; es ist groß und geheimnisvoll und hat heute, unter dem Glanz des rinnenden Regens die kräftige Färbung alter mit Grünspan versetzter Bronze angenommen. Davor, ganz zu seinen Füßen, reihen sich schwarz gewordene Beduinenzelte, und dahinter wird ein Teil des alten Jerusalem sichtbar; die Stadtmauern, welche die Kuppelhäuser umschließen, reichen unter dem regenschweren Himmel bis in die Steinwüste des Umlands hinein. Das Ganze hat den gleichen grünlichen Bronzeton wie das Tor selbst angenommen; es erscheint tausendjährig, verlassen und tot, und doch ist es Jerusalem, das Jerusalem, das wir auf ehrwürdigen Gemälden und alten Bildern gesehen haben; wenn man aus dem schrecklichen neuen Vororten kommt, in denen Fabrikschlote rauchen, möchte man eine heilige Vision glauben.
Die Dominikanermönche empfangen uns im Besuchszimmer ihrer Niederlassung. Sie führen uns in ihrem Garten zu einer ersten Kostbarkeit; sie haben sorgfältige Ausgrabungen vorgenommen und wertvolle Ruinen freigelegt. Der Untergrund Jerusalems, über Jahrhunderte immer wieder umgegraben, bewegt, angegriffen, zerstört, birgt noch so viele Überreste und unbekannte Zeugnisse.
Dreihundert Meter vom Damaskustor entfernt wurde der hl. Stephanus auf einem Feld hingerichtet, und Kaiserin Eudoxia ließ dort eine Kirche errichten, um die Erinnerung an die Stelle seines Martyriums zu bewahren. Die Mönche haben Reste dieser Kirche wiederentdeckt, ihr wunderschöner Mosaikboden ist noch intakt, aber die Sockel ihrer Marmorsäulen sind alle einen Fuß hoch über dem Boden zerschlagen.
Es war der furchtbare Khosroes, der als erbitterter Christenfeind um die Mitte des 7. Jahrhunderts den heiligen Ort verwüsten ließ. | | Khosroes II., 590 - 627 Großkönig des Neupersischen Reiches, der Krieg gegen das Byzantinische Reich führte und Kleinasien und Jerusalem plündern ließ. |
Ganz in der Nähe befinden sich auch die Fundamente einer bescheideneren Kapelle, die später die Kreuzfahrer in Erinnerung an den hl. Stephanus erbauen ließen, und die ihrerseits zerstört wurde, als der Sarazenensturm über Jerusalem herniederging. All diese armseligen und doch herrlichen Zeugnisse liegen nass vom Regen vor uns, inmitten von Schutt aus neuerer Zeit, noch halb verdeckt von der Erde, die sie Jahrhunderte lang geborgen hatte.
Dann prasselt erneut ein Sturzregen hernieder und wäscht mit reichlich Wasser den Marmor und die Mosaiken der Kaiserin Eudoxia. Wir flüchten uns in eine der Grabstätten, die die Mönche ebenfalls im Untergrund ihres Garten entdeckt haben: eine kleine unterirdische Nekropole mit übereinander liegenden Gräberreihen, in denen die zweimal tausend Jahre alten Knochen zerbröseln. Jetzt bestatten die Dominikaner dort die Toten ihrer Gemeinschaft, die verstörten Christen unserer Zeit, die neben ihren Brüdern der ersten Jahrhunderte ruhen.
Der Regen lässt nach. Mit einem Araber als Führer stehle ich mich allein aus dem Hotel, um endlich zum Heiligen Grab zu finden. Es liegt in entgegengesetzter Richtung zum Dominikanerkloster, fast im Herzen von Jerusalem. Enge Gassen winden sich zwischen Mauern aus der Zeit der Kreuzzüge, ohne Fenster, ohne Dach. Über das nasse Pflaster wandern die Trachten des Orients, Türken, Beduinen oder Juden und Frauen wie verhüllte Gespenster, Muselmaninnen unter dunklen, Christinnen unter weißen Schleiern.
Die Stadt ist orientalisch geprägt. Zerstreut nehme ich wahr, dass wir einen orientalischen Bazar durchqueren, in dessen Läden die Verkäufer den Turban tragen; im Halbdunkel der überdachten Gassen zwingt uns eine langsame Reihe riesiger Kamele, Zuflucht in den Türöffnungen zu suchen.
Und nun muss man wieder zur Seite gehen, es folgt ein langer seltsamer Zug russischer Frauen, alle mindestens sechzigjährig; sie gehen schnell, auf Stöcke gestützt; ihre Kleider sind alt und abgetragen, alt ihre Schirme, alt ihr Umhang aus Lammfell, ihre von schwarzen Kopftüchern umrahmten Gesichter sprechen von Erschöpfung und Schmerz; ein düsterer trauriger Anblick inmitten des farbenfrohen Orients. Sie bewegen sich schnell, erregt und erschöpft zugleich, wie Schlafwandlerinnen stoßen sie alles beiseite ohne wirklich hinzusehen, ihr Blick ist wie betäubt, die Augen weit geöffnet, als sähen sie einen himmlischen Traum. Ihnen folgen Hunderte von Moujiks mit dem gleichen entrückten Gesichtsausdruck; alle sind alt und schmutzig, sie haben lange graue Bärte, lange graue Haare kommen sich unter ihren Pelzmützen hervor; auf der Brust tragen sie Orden zum Zeichen, dass sie Soldaten waren. Gestern sind sie in die Heilige Stadt gekommen, nun haben sie den ersten Gang zum Ort der Anbetung hinter sich, zu dem ich auch unterwegs bin; arme Pilger sind es, die hier zu Tausenden ankommen. Sie legen den Weg zu Fuß zurück, sie schlafen im Freien bei Regen und Schnee, sie leiden Hunger und lassen so manchen Toten zurück.
Je mehr man sich nähert, desto auffälliger machen die orientalischen Auslagen in den Läden Platz für Devotionalien von unbestimmter christlicher Frömmigkeit: Tausende Rosen-kränze, Kreuze, Votiv-lämpchen, Bilder oder Ikonen. Das Gedränge nimmt zu. Alte Mujiks und alte Mattuschkas bleiben stehen, um einen bescheidenen kleinen Rosenkranz aus Holz, ein bescheidenes kleines Kreuz zu kaufen, das sie als für immer geweihte Reliquie von hier mitnehmen werden.
Schließlich erscheint in einer Mauer, die alt und rau wie ein Felsen ist, eine seltsam geformte, schmale und niedrige Tür, und über eine Treppe steigt man zu einem Platz hinunter, der, von hohen dunklen Mauern überragt, der Grabeskirche direkt gegenüber liegt.
Es ist Brauch, auf diesem Platz die Kopfbedeckung abzunehmen, sobald man der Grabeskirche ansichtig wird. Man geht mit unbedecktem Haupt weiter, selbst wenn man nur seinen Weg durch Jerusalem nicht anhalten will.
Der Platz ist gedrängt voll von singenden Bettlern und Bettlerinnen, von betenden Pilgern, von Verkäufern, die Kreuze und Rosenkränze vor sich auf den alten, abgenutzten und ehrwürdigen Steinen ausgebreitet haben. Eingelassen zwischen Pflaster und Stufen zeigen sich noch die Sockel von Säulen, die einstmals Kirchen als Stützen dienten, und die in längst vergangenen unsicheren Zeiten zerstört wurden; Trümmerhaufen liegen überall in dieser Stadt herum, die zwanzig Mal belagert wurde, die von Fanatikern aller Art heimgesucht wurde.
Die rötlich-braunen Mauern an den Seiten des Platzes gehören zu Klöstern oder Kapellen – aber man könnte sie für Befestigungen halten. Im Hintergrund erhebt sich höher und dunkler als sie alle die Fassade der Grabeskirche wie ein bröckelndes brüchiges Massiv. Durch ihre unregelmäßige Gestalt sieht die Kirche wie ein großer Felsen aus; es gibt dort zwei große Eingangstüren aus dem 12. Jahrhundert. Ihre Einfassungen haben eigenartige eher archaisch wirkende Verzierungen ; die eine Tür ist zugemauert, die andere weit geöffnet und man sieht im Dunkel des Innenraums das Leuchten unzähliger kleiner Flammen. Gesänge, Schreie, misstönende Klagerufe, schaurig anzuhören, dringen vermischt mit Weihrauch nach außen…
Heute Morgen machen wir uns auf den Weg zum heiligen Ort der Araber, der herrlichen und besonders verehrungswürdigen Omar-Moschee.
Als Omar-Moschee bezeichnet Loti hier den Felsendom, der im eigentliche Sinne keine Moschee sondern ein Sanctuarium ist. Er nennt sie wegen der blauen Fayencen ihrer Verkleidung vielfach auch Blaue Moschee. |
Der französische Konsul und Pater, S., ein Dominikaner, begleiten uns – zudem geht uns ein Janitschar vom Konsulat voran, ohne den uns der Zugang zur Moschee nicht gestattet würde.
Wir gehen durch enge und trotz des hellen Sonnenscheins dunkle Straßen, zwischen alten fensterlosen Mauern, gebaut aus dem Schutt aller Epochen der Geschichte, in die hier ein Stein mit hebräischen Schriftzeichen, dort ein römischer Marmorquader eingelassen ist. Je weiter wir kommen, desto mehr erscheint alles verfallen, leer und tot, bis hin zum heiligen Bezirk zeigt sich unendliche Trostlosigkeit, die sogar den Moscheebereich selbst umgibt, dessen Eingänge von türkischen Posten bewacht werden, die Christen den Zutritt verwehren. Dank des Janitscharen überwinden wir diese unerbittliche Sperre und gelangen schließlich durch eine Reihe kleiner verwitterter Tore auf eine riesige Esplanade, eine Wüste voller Melancholie, wo zwischen den Bodenplatten das Gras hervorwächst wie auf einer Wiese, wo kein menschliches Wesen zu sehen ist: der Haram El Sharif, der Heilige Bezirk.
In seiner Mitte erhebt sich, recht weit von uns entfernt, da wir den Platz von der Seite her betre-ten, ein einzelnes erstaunliches Bau-werk ganz in Blau, einem außer-gewöhnlich seltenem Blau; es wirkt wie ein altes verzaubertes, von Türkissteinen überzogenes Schloss: die Omar-Moschee, das Wunder des Islam. Welch großartige eindrucksvolle Einsamkeit haben die Araber um ihre blaue Moschee zu legen gewusst!
Düstere Konstruktionen umgeben diesen Platz an jeder seiner mindestens fünfhundert Meter langen Seiten, sie lassen aufgrund ihrer Baufälligkeit gar keine bestimmte Form erkennen, viele Reparaturen und Umbauten aus allen Epochen der Geschichte lassen über ihre Funktion im Unklaren: zyklopische Steine in den Fundamenten sind noch bestehende Reste der salomonischen Tempelmauer, darüber liegt der Schutt der Zitadelle des Herodes, der Schutt der Festung, in der Pontius Pilatus residierte und von der Jesus Christus zu seinem Leidensweg aufbrach, dann folgten die Verwüstungen und Zerstörungen durch die Sarazenen und anschließend durch die Kreuzfahrer, und als letztendlich die Sarazenen wieder die Herrschaft übernahmen, vergitterten oder vermauerten sie die Fenster, errichteten überall ihre Minarette versahen den oberen Rand der Bauwerke mit spitzen Zinnen. Die gnädige Zeit bedeckte alles mit der gleichmäßigen Farbe alten rotbraunem Lehms, mit Gewächsen, mit Verfall, mit Staub.
Das Durcheinander aus Brocken und Bruchstücken ist Jahrtausende alt und immer noch großartig anzusehen; es bezeugt die Nichtigkeit des Menschen, den Zusammenbruch von Kulturen und Rassen, es verbreitet eine unendliche Traurigkeit in der kleinen Wüstenei dieser Esplanade, auf der sich ganz allein der schöne blaue Palast mit seiner hohen Kuppel und dem Halbmond erhebt, die schöne unvergleichliche Omar-Moschee.
Wir durchschreiten den leeren Raum, der, obgleich mit großen weißen Steinplatten gepflastert, dennoch wie ein Friedhof von Pflanzenwuchs überwuchert ist. Die Verkleidung der blauen Moschee zeichnet sich bald deutlicher ab: die Mauern bedeckt ein feiner durchbrochener Schmuck wie von Edelsteinen, zur Hälfte je blasser Türkis und kräftiger Lapis, mit etwas Gelb, etwas Weiß, etwas Grün, etwas Schwarz, maßvoll zu sehr feinen Arabesken zusammengefügt.
Zwischen ein paar vertrockneten Zypressen und einigen sterbenden Olivenbäumen leisten mehrere Nebengebäude im inneren Teil der Esplanade der Moschee Gesellschaft, die aber als großes Wunder im Zentrum steht. Wir sehen zwei kleine Mihrabs aus Marmor, freistehende Arkaden, kleine Triumphbögen, einen ebenfalls mit blauem Schmuckwerk verkleideten Säulenpavillon.
Alles so traurig, so melancholisch, so verwahrlost anzusehen auf diesem weiten Platz, wo der Frühling Kränze aus Margeriten, Butterblumen und wildem Hafer hinterlassen hat. Aus der Nähe erkennt man, dass sich diese kleinen, eleganten und lichtdurchfluteten Bauten der Sarazenen aus dem Resten christlicher Kirchen und antiker Tempel zusammensetzen; die Säulen, die Marmorfriese passen alle nicht zusammen, hier entriss man sie einer Kreuzfahrerkapelle, dort einer griechischen Kaiserbasilika, einem Venustempel oder einer Synagoge. Die Anlage wirkt insgesamt arabisch, ruhig und anmutig wie Aladins Paläste, im Detail aber lehrt sie uns vieles über die Zerbrechlichkeit von Religionen und großen Reichen; das Detail bewahrt die Erinnerung an die schlimmen Vernichtungskriege, an die furchtbaren Plünderungen, an die Tage, „als hier Blut in Strömen floss und das Morden erst endete, wenn die Soldaten müde vom Töten waren“.
Gerade der blaue Pavillon neben der blauen Moscheekönnte allein von der schrecklichen Vergangenheit Jerusalems erzählen. Seine doppelte Säulenreihe ist wie ein Museum für die Reste aller Zeiten; man sieht griechische, römische, byzantinische oder hebräische Kapitelle; andere wiederum sind, was Alter und Stil angeht, nicht einzuordnen.
Gemeint ist der Kettendom, in | |
Am Rand des so weitläufigen Platzes öffnet sich zwischen alten Zypressen der blick auf eine weitere tausendjährige, von Muslimen hoch verehrte Moschee – die Al Aksa (die Ferne Moschee), - deren verschiedenartige Säulen und Kapitelle ebenfalls aus zerstörten heidnischen Tempeln oder christlichen Kirchen der frühen Kreuzfahrerzeit stammen; von ihr erhielten die edlen Ritter, die dort Quartier nahmen, ihren Namen: die Templer. So schön sie für das unvoreingenommene Auge auch sein mag: wir können ihr keine Bewunderung mehr zollen, als wir aus der unbeschreiblichen Felsenmoschee kommen.
Nun wandern wir ziellos über das armselige Gras und über die großen Steinplatten, unter herrlicher Frühlingssonne, eine kleine verlorene Gruppe in der Einsamkeit dieses heiligen Ortes. Hier und da fehlt eine Platte, dort wachsen stattdessen wilde Blumen und Sträucher wie auf einer Wiese. Im Umkreis der türkisfarbenen Moschee treffen wir beim Umhergehen auf einzelne Bauten geringerer Größe, die sich planlos um sie herum verteilt: der blauen Pavillon, die Mihrabs und die marmornen Triumphbögen, ein paar alte Olivenbäume und abgestorbene Zypressen; welch eindrucksvolle Trauer herrscht in diesem Bezirk, der das schweigende Herz des antiken Jerusalem darstellt.
Von einer Stelle blickt man von der Esplanade aus unerwartet in eine Schlucht; dort wird die Umfassungsmauer von schmalen Öffnungen durchbrochen.
„Schauen Sie“, sagt der Weiße Vater und weist mit der Hand auf eine dieser Schießscharten.
Mein Blick folgt der Bewegung und schaut in die Richtung, die sie weist:
Ach! welch dunklen Abgrund zeigt sich!
Eine seltsame Schlucht, die ich heute Morgen zum ersten Mal bemerke und dennoch sofort erkenne: es ist das Tal Josaphat. Ich erzittere leicht bei seinem Anblick durch die enge Schießscharte.
Ganz unten, in den letzten Falten dieser Schlucht verläuft das Bett des ausgetrockneten Flusses Kidron. Auf dem gegenüber liegenden Abhang, erkennt man, unendlich traurig anzusehen, das sognannte Grab des Absalom und des Josaphat. Daran anschließend breitet sich in einer ebenso bedrückendem Stille wie hier oben, in einer Verlassenheit, gleich der der heiligen Esplanade, das Tal der Toten aus. Grab um Grab die gleichen Steine, verstreut bis ins Unendliche, ungezählt wie die Kiesel am Meeresstrand.
Nun begeben wir uns in den Untergrund des Haram Al Sharif – denn jener Teil dieses einsamen Platzes, der oberhalb des Tals Josaphat liegt, ist künstlich angelegt und wird durch einen gigantischen Unterbau gestützt, durch ein ganzes Universum von Pfeilern und Bögen. König Salomon selbst wollte, ein Mann der Alten Zeit mit großartiger Vorstellungskraft, den Tempelbereich vergrößern und ihm noch mehr Pracht verleihen. Der Unterbau des Haram El Sharif, ist eine Art Katakomben, ausgestattet mit parallel angeordneten Arkaden und Stalaktitenbögen, und zeigt uns, von welchem Ausmaß die Werke des Altertums waren, wie machtvoll im Vergleich zu den unseren. Zu Zeiten der Kreuzzüge diente das unterirdische Gewölbe der fränkischen Kavallerie als Quartier, an den Wänden sieht man noch die eingelassenen Eisenringe, an denen die Tempelritter ihre Pferde festmachten.
In der Umfassungsmauer des Haram-El-Sharif sind noch zwei Tore des früheren Tempels von Jerusalem erhalten geblieben. Durch das eine, das Goldene Tor oberhalb des Kidron-Tals, soll zuverlässiger Überlieferung zufolge Jesus am Palmsonntag unter dem Jubel des Volkes in die Stadt gezogen sein. Heute ist es durch Mauerwerk aus sarazenischer Zeit verschlossen; es wurde außerdem in der Vergangenheit mehrmals unter Verwendung unterschiedlicher Stilformen umgebaut.
| |
Das andere, das Doppeltor genannt, war einst die mittlere Pforte, durch die man zum Tempel hinaufstieg, wenn man aus Ophel kam.
Ophel bezeichnet hier eine Siedlung südwestlich der Altstadt. Demnach kann es sich nur um eines der Huldah-Tore handeln, das durch einen Kreuzfahrerbau fast verdeckt wird. |
Dieses Tor war gewiss Zeuge als Salomons begleitet von der Königin von Saba in die Stadt Einzog. Die Archäologen streiten zurzeit darüber, ob die letzten Umbauten aus der herodianischen oder der byzantinischen Epoche stammen. Unter dem Tor liegen geheimnisvolle unterirdische Räume und es ruht auf Fundamenten von zyklopischem Ausmaß; mehr noch als das andere Tor lässt es an eine schwere und dunkle Zeit der Antike denken. In der Mitte wird das Tor von einer monolithischen Säule geteilt, die wahrscheinlich den letzten noch vorhandenen Überrest des Salomonischen Tempels darstellt; sie ist plump und wenig elegant, sie endet in einem schlichten, mit Palmen verziertem Kapitell, über dem eine riesige Steinplatte liegt, die wohl nur Menschen der Urzeit auf geheimnisvolle Weise bewegen konnten, als wären sie so leicht wie Stroh, während unsere modernen Maschinen unter ihrem Gewicht zusammenbrechen würden. Die gesamte Anlage ist unter der Schicht aus Gips und Kalk kaum noch vollständig zu erkennen, sie scheint der Rest eines in dunkler Vorzeit von Riesen errichtetes Gebäude zu sein. Angesichts dieser Säule und dieser Steinplatte erhält man einen Eindruck, welch großartige Ausmaße der ursprüngliche Tempel des Herrn einst gehabt haben mag, der heute zur Einöde des Harem-Al-Sharif geworden ist, in der einsam die Blaue Moschee thront.
Freitagabend. Zu dieser Zeit kommen gemäß der Tradition die Juden jede Woche auf den Ruinen des Salomonischen Tempels zusammen, um zu klagen. Die Türken haben es ihnen einen fest bestimmten Ort gestattet.
Wir wollen uns vor Einbruch der Nacht an diesem Ort des Klagens begeben. Über einige brachliegende Flächen gelangen wir nun durch enge Gassen voller Unrat zu einem Bezirk, in dem viele Menschen gemeinsam eine leise rhythmische Klage ausstößt, die uns fremdartig vorkommt.
Die Abenddämmerung setzt ein. Dunkle Mauern umschließen den Platz, dessen gegenüberliegende Seite durch einen großartigen Bau aus Salomonischer Zeit begrenzt wird, ein Rest der einstigen Tempelmauer aus riesigen völlig gleichen Steinblöcken.
Männer in langen Samtkleidern wenden uns den Rücken zu. Indem sie die Körper gemeinsam vor und zurück wiegen, wenden sie das Gesicht der Ruine zu, schlagen die Stirn gegen die Steine, begleitet von einer Art zittrigem Singsang. Ihre Kleider sind beeindruckend: schwarzer Samt, blauer Samt, violetter oder hellroter Samt, mit wertvollem Pelz gefüttert. Die Kalotten sind alle aus schwarzem Samt, mit langflorigem Pelz besetzt.
Zu der Tempelmauer hin, die als letztes Zeugnis des vergangenen Glanzes geblieben ist, wiederholen sie die Klagen des Jeremiah, rhythmisch und in schnellem Wiegen des Körpers:
- Wegen des zerstörten Tempels, ruft ein Rabbiner
- Sitzen wir hier allein und weinen! antwortet die Menge.
- Wegen der Mauern, die sie eingerissen haben,
- Sitzen wir hier allein und weinen!
- Wegen unseres Königs, der gestorben ist, wegen der großen Männer, die dahingeschieden sind!
- Sitzen wir hier allein und weinen!
Zwei oder drei dieser Alten vergießen wahrhafte Tränen; sie haben ihre Bibeln in die Nischen zwischen den Steinen gesteckt, um die Hände frei zu haben, die sie über dem Kopf bewegen. Wenn alte Köpfe und weiße Bärte die Mehrheit an dieser Klagemauer bilden, so deshalb, weil aus der ganzen Welt, in die Israel zerstreut ist, dessen Söhne hierher zurückkehren, um im heiligen Tal Josaphat begraben zu werden. Und Jerusalem füllt sich mehr und mehr mit Greisen, die gekommen sind, um zu sterben.
Ist es nicht einzigartig, berührend und erhaben: nach so viel unfassbarem Unglück, nach so vielen Jahrhunderten des Exils, der Zerstreuung, hat die unerschütterliche Treue dieses Volkes eine verlorene Heimat wiedergefunden. Vor dieser Klagemauer erscheint das Mysterium der Prophezeiungen noch unerklärlicher und noch ergreifender. Andächtig verharrt hier den Geist, verwirrt vom Schicksal Israels, das beispiellos und ohne Gleichen in der Menschheitsgeschichte ist, unvorhersehbar und doch vorhergesagt, sogar schon zu Zions Zeiten, mit einer erschütternden Genauigkeit.
- Bring deine Kinder zurück nach Zion! Eile dich, eile dich, Befreier Zions!
Die alten Hände liebkosen die Steine, die alten Stirnen stoßen gegen die Mauer, und im gleichen Rhythmus bewegen sich die grauen Haare, grauen die Schläfenlocken.
Inzwischen sind tagtäglich neue Pilgergruppen angekommen. Um diese Zeit herrscht äußerst reges Treiben in Jerusalem. Von allen Gegenden eilen die Menschen in Massen herbei, und Kirchen bereiten sich auf das anstehende Osterfest vor. Die engen Straßen fassen kaum die Menschen aus allen Ländern der Erde. Pilger ziehen in Prozessionen vorbei, sie singen geistliche Lieder, es gibt Prozessionen von griechischen Kindern, die mit hoher näselnder Stimme psalmodieren; die Züge der Pilger treffen auf Züge von Eseln mit muschelverziertem Zaumzeug, deren unzählige Glöckchen bimmeln wie das Carillon einer Kirche; und ein zusätzliches Hindernis sind die von ungestümen Beduinen geführten Kamele, große harmlose und bedächtige Tiere, die mit ihren viel zu großen Lastenbündeln an den Auslagen der Kreuz- und Rosenkranzverkäufer hängen bleiben.
Als der Tag sich neigt, steige ich zum Kidron hinunter. Zu dieser Stunde breitet sich eine an Furcht grenzende Melancholie, die sich weder benennen noch beschreiben ließe, im Tal des Jüngsten Gerichts aus. Als der Weg eine Biegung macht, liegt es vor mir, schweigend und tief. Ich komme zuerst an den Teil, der den Muslimen überlassen ist, er liegt bereits im Schatten der Abenddämmerung, während an der gegenüberliegenden Seite unzählige jüdische Gräber und die Ruinen von Ophel und Siloë mit ihren Höhlen und Grabsteinen noch in einem übernatürlich erscheinenden Abendrot leuchten; jeden Abend geschieht das seit jeher, immer in gleicher Weise, und am nächsten Morgen ist es umgekehrt, wenn die Morgenröte mit zartem Schein auf die muselmanische Seite fällt, während es über der israelitischen Seite erst allmählich hell wird; jeden Morgen ohne Unterlass wiederholt sich das unendliche Wechselspiel des Lichts. Heute Abend ist das Tal Josaphat wie gewöhnlich leer; nur undeutlich nimmt man in seiner ganzen Weite hier und da, am Hang eines Hügels, einen beduinischen Schäfer wahr, der seine Ziegen bewacht. Das Tal ist leer und vermittelt den Eindruck düsterer Feierlichkeit. Durch seine Stille hört man manchen Vogelruf, und dann, in der Ferne das schnelle Hämmern der Steinmetzen, leise und klangvoll, wie sie hier seit ewigen Zeiten damit beschäftigt sind, Namen in die Steine zu ritzen; die Friedhöfe dieses Tals kommen nie zur Ruhe, und die Erde ist Tag und Nacht eifrig bemüht, die toten Körper in sich aufzunehmen.
Zunächst war ich an jenem Teil der Tempelmauer stehen geblieben, von dem man aus der Höhe in das Tal blickt. Nun steige ich hinab, tauche ein in die Traurigkeit dort unten, über schmale Pfade, die von Gras und roten Anemonen fast zugewachsen sind; der schwere Schatten der Stadtmauer von Jerusalem folgt mir beim Abstieg, in dem Maße, wie die Sonne jetzt sinkt, wird er länger. Zwischen den Gräbern steigert sich von Tag zu Tag die große Blumenpracht, eine sehr vergängliche Pracht in einem Land, wo alles schnell vertrocknet, wo alles verbrennt, sobald der Frühling vorbei ist. Vor mir stehen nun drei düstere Mausoleen, die Gräber des heiligen Jakob, des Absalom und des Josaphat, drei Monolithen aus rötlichem Granit, welche die Versammlung von Grabsteinen überwachen.
Ich kehre um und steige auf die muselmanischen Seite des Tals wieder nach oben, an der Böschung der westlichen Hügel, über denen die lange Stadtmauer Jerusalems thront, deren Zinnen sich wie Spitzenbesatz vor dem gelblichen Himmel abheben.
Das Licht weicht. Auch die beduinischen Hirten kehren unter schwermütigem Singsang nach Siloë zurück. Am Ende meines ziellosen Spaziergangs fällt mir ein, dass Freitag ist, eine mehr Langeweile als Neugierde lockt mich durch die einsame Unterstadt wieder zu der Klagemauer, an der ich eine Woche zuvor gewesen bin.
Unterwegs sehe ich in den Gassen lauter tote Hunde, tote Katzen und Unrat aller Art liegen. Ich treffe auf eine große Gruppe, die aus spöttischem Interesse dasselbe Ziel hat, neapolitanische Pilger, von Mönchen begleitet, Männer und Frauen mit einem roten Kreuz auf der Brust. Sie gleichen den lärmenden Horden, die im Süden Frankreichs nach Lourdes strömen.
Mit diesem unseligen Haufen erreiche ich gemeinsam die Tempelmauer. Die gleichen Samtkleider, die gleichen grauen Schläfenlocken, die gleichen alten erhobenen Hände, in Treue sind sie gekommen, die Alten des Volkes Israel, die bald die Pflanzen im Tal Josaphat fruchtbarer machen werden; allerdings sind es weniger als am vergangenen Freitag, sie sind auch lauter, als sie die Klagelieder des Propheten singen.
Vor unserer Invasion, so muss man es wohl nennen, hatte sich bereits eine ganze Bande arabischer Kinder eingefunden, um sie zu quälen: als Tiere verkleidet, als Hunde unter braunem Sackleinen, laufen sie auf allen Vieren zwischen ihren Beinen umher und bellen unter lautem Gelächter. An diesem Abend tun sie mir leid, sehr leid, diese gebeugten Rücken.
Heute will ich meine Zeit mit den Vertretern der äußerst denkwürdigen armenischen Gemeinschaft verbringen, deren Geschichte seit dem Altertum stets so unruhig und schmerzvoll verlief.
Ihre Gebäude sind befestigt wie die Zitadellen des Mittelalters und nehmen fast die Hälfte des Zionsberges ein, dessen östlicher Teil den Israeliten gehört.
Bevor wir unseren Gang durch dieses besondere Viertel beginnen, möchten wir Seiner Heiligkeit dem Patriarchen mit einem Dankesbesuch aufwarten, und man führt uns in einen Empfangsraum, der so groß ist wie der Saal eines Schlosses. Dort sollen wir auf ihn warten. Kurz darauf tritt er durch eine Tür, deren Vorhänge von zwei Priestern mit schwarzen Kapuzen feierlich hochgehoben werden, er setzt sich zu uns auf seinen Thron. Unter der schwarzen Haube zeigen sich ein edel geformter Kopf, feine Gesichtszüge mit asketischer Blässe, ein weißer Bart wie der eines Propheten, Augen und Brauen so schwarz wie die eines Orientalen. In seiner Begrüßung, in seinem Lächeln, in seiner ganzen Gestalt liegt eine vornehme und liebendwürde Anmut, und etwas fremdartig Asiatisches. Inmitten des Zeremoniells wirkt er an diesem historischen Ort wie ein Würdenträger aus alter Zeit. Er empfängt uns auf die türkische Art: mit Kaffee und der traditionellen Rosenkonfitüre.
Außer der Kirche und den Klöstern verfügt das Armenische Viertel über eine große Zahl riesiger alter Gasthäuser, die bis zu dreitausend Pilger aufnehmen könnten, mit Mauern von drei oder vier Metern Dicke, mit Vorratstürmen und einer Zisterne, die Wasser für vier Jahre führt: Maßnahmen aus alter Zeit zum Schutz gegen Belagerung, Überraschungsangriffe, Massaker.
Als letztes betreten wir die Kirche, die eine der ältesten und interes-santesten in Jerusalem ist. Neben dem Eingangsportal hängt noch das traditionelle Simandron, das die Gläubigen herbeiruft, wie wir es schon im Sinaïkloster gesehen hatten. Das Innere hat Züge sowohl einer byzantinischen Basilika als auch einer Moschee, wirkt aber durch die wertvollen blauen Fayencen an allen Wänden und den massiven Pfeilern zugleich wie ein arabischer Palast. Der Thron für die Patriarchen, die niedrigen Türen zu den Sakristeien und Nebenräumen sind mit sehr alten orientalischen Mosaiken aus Muscheln und Perlmutt verkleidet. Vom Gewölbe hängen unzählige Straußeneier in seltsamen ziselierten Silberfassungen herab; auf dem Hauptaltar ruht ein Triptychon aus feinem Gold mit durchsichtigem Emailüberzug. Auf dem Steinfußboden liegen dicke türkische Samtteppiche in Blau, Gelb oder Rosa. Lange Vorhänge fallen von der Decke herab und verdecken die drei Tabernakel im Hintergrund. Sie werden, so erklärt man uns, jede Woche gewechselt; wenn in einigen Tagen das Osterfest gefeiert wird, werden sie besonders aufwändig sein; diejenigen, die man zurzeit sieht, zeigen aufgereihte Heiligenfiguren. Sie wurden vor rund hundert Jahren von der armenischen Gemeinde in Indien gestiftet.
Links neben dem Eingang befindet sich innerhalb der Basilika eine kleine, in die dicke Mauer eingelassene Marmornische. Das ist die Stelle, an der der heilige Jakobus enthauptet und sein Haupt aufbewahrt wurde. (Sein Körper ist bekanntlich in Santiago de Compostela.) Mit Perlmutt verkleidete Türen verbinden den Kirchenraum mit Seitenkapellen, in denen man uns weitere ungewöhnliche Tabernakel in fremdartigem, fast indisch wirkendem Stil zeigt. Sie sind hinter Vorhängen aus altem Damaszener Samt oder Seide aus Bursa verborgen. Wir sehen sogar Säulen, die man einst aus dem Felsendom entwendet hat, was man auch unschwer erkennt. In Jerusalem herrscht ein solches Durcheinander aus Schutt und Glanz, dass solche Verbindungen nicht verwundern. Wir haben die Stürme, die über diese heute so ruhig gewordene Stadt hinweggegangen sind, tief verinnerlicht, so auch die unglaublichen Erschütterungen, durch die die Erde ihres alten Gottesackers immer wieder Umwälzungen erlebt hat.
In einer der mit herrlichen blauen Fayencen aus unbekannter Zeit verzierten Sakristeien, wird der armenische Priester, der uns begleitet, plötzlich zornig und schimpft auf Khosroes II., den Schrecklichen, der, um sich bei seinen Vernichtungswerk ja nichts auszulassen, fünf Jahre lang in der Stadt blieb, um die Kirchen bis zu den Fundamenten zu zerstören, um zu zerschlagen, was man nicht mitnehmen konnte, der mehr als fünftausend Mönche in die Gefangenschaft führte, und der das wahre Kreuz bis ins tiefste Persien verschleppte. Wie seltsam klingt es, noch in unserer Zeit jemanden zu hören, der bei der Erinnerung an Khosroes erzittert! Mehr noch als die Gestalt des Ortes, der uns umgibt, verschwindet für einen Moment jedes Gefühl für das Jahrhundert, in dem wir leben.
Da ich nun schon auf dem Zionsberg bin, will ich bis zum Sonnenuntergang durch das Viertel der Juden streifen, die besonders nach den letzten Verfolgungen in Russland massenhaft nach Jerusalem zurückkehren.
Es ist Sabbattag und im Viertel ist es ruhig. All die kleinen Läden, wo sich Kleider neben Eisenwaren türmen, sind geschlossen, und das vertraute Hämmern der unzähligen Blechschmiede ist nicht zu hören. Die schönen Kleider aus Samt und Pelz, die man am gestrigen Abend aus den Truhen geholt hat, um sie zur Klagemauer zu führen, wandeln heute unter der Aprilsonne. Einige Männer tragen festliche Kleidung durch die engen Straßen spazieren, das Buch der Psalmen in der Hand.
Französischer Text:
Links zu den Bildern:
https://www.youtube.com/watch?v=Gyu7jFnj9Nw
https://www.youtube.com/watch?v=f3dp3frgxXg
https://www.youtube.com/watch?v=iT37R_6ljxc
https://www.youtube.com/watch?v=kcQDW-bsRLE
https://www.youtube.com/watch?v=fIpYO3rme-s
https://www.youtube.com/watch?v=opFiVOo2WsY